
Last update of this page: 08.10.1999
 |
Last update of this page: 08.10.1999 Die Quellen für polarisierte
This page in english
|
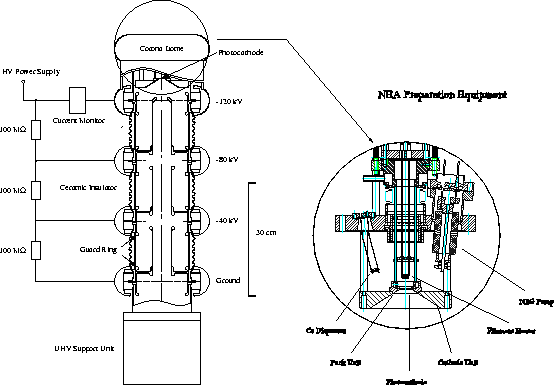
Seit April 1997 wird in der Quelle ein sogenannter superlattice-Kristall eingesetzt, (die Entwicklung einer japanischen Arbeitsgruppe an der Universität Nagoya), mit dem ein Polarisationsgrad des Elektronenstrahls von 66% erreicht wird.
Nach einer elektrostatischen Vorbeschleunigung auf 120 keV werden die zunaechst longitudinal (also in Flugrichtung) polarisierten Elektronen in einem elektrostatischen Deflektor um 90 Grad abgelenkt. Dabei bleibt jedoch die ursprüngliche Ausrichtung des Polarisationsvektors abgesehen von relativistischen Effekten erhalten, so daß die Elektronen danach nahezu transversal zur Flugrichtung polarisiert sind. Transversale (vertikale) Polarisationsrichtung ist nötig, um den Polarisationsgrad während der anschließenden Beschleunigung in den beiden Zirkularbeschleunigern (Booster und ELSA) zu erhalten. Außerdem erlaubt die transversale Polarisation eine Messung durch Mott-Streuung an dünnen Goldfolien direkt hinter der Quelle.
Der transversal zu Impulsrichtung stehende Polarisationsvektor wird im Linac von den zur Fokussierung des Elektronenstrahls eingesetzten Solenoid-Linsen beeinflußt. Dieser Einfluß auf den Polarisationsvektor kann in der Strahlführung vor dem Linac durch entsprechende Vordrehung des Vektors mit Solenoidmagneten kompensiert werden. Hiermit kann der Polarisationsvektor genau in die benötigte vertikale Richtung ausgerichtet werden.
Während des Betriebs der Quelle nimmt die Intensität allmählich ab. Dabei hängt die Lebensdauer der Quelle vor allem auch stark von der Güte des Vakuums ab. Um den schädliche Einfluß einiger Komponenten des Restgases gering zu halten, wird die Quelle bei Drücken kleiner 10-11 mbar betrieben. Damit ein hoher Photostrom aus dem Kristall gezogen werden kann, wird die Kristalloberfläche im Vakuum ausgeheizt und anschließend mit geringen Mengen von Cäsium und Sauerstoff präpariert (NEA-Oberfläche). Nach ca. 50 Std Betrieb mit der Quelle ist die Anfangsintensität auf 1/e abgefallen. Durch wiederholtes Nachcäsieren (dauert ca. je 1 Std) kann die Betriebszeit auf etliche Tage erhöht werden. Um nahezu wieder die Anfangsbedingungen zu erreichen, muß der Kristall aber erneut ausgeheizt werden (mit anschließender Präparation der Oberfläche). Eine Prozedur, die fast einen Tag dauert.
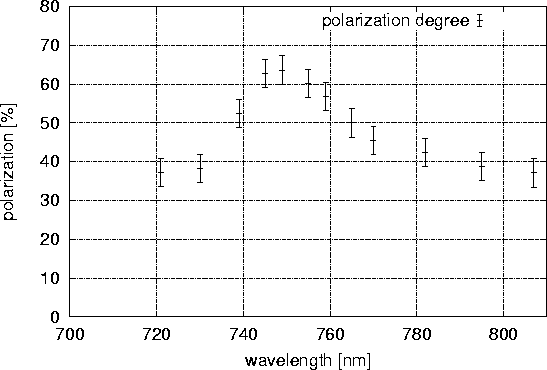
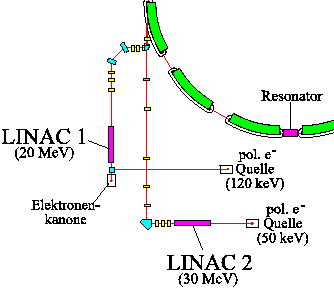 Um eine größere Verfügbarkeit und Betriebssicherheit bei
Experimenten mit polarisierten Elektronen zu erreichen, wurde eine weitere
Quelle aufgebaut. Bei der Konstruktion dieser Quelle wurden neueste
Erkenntnisse berücksichtigt. Die mit einer Energie von 50 keV erzeugten
polarisierten Elektronen werden in den Linac 2 eingeschossen. Durch die neue
Strahlführung vom Linac 2 zum Synchrotron erreicht man eine stark
verbesserte Transfereffizienz. Die Quelle und der Linac wurden Anfang 2000
in Betrieb
genommen Mit dieser Quelle wurden am GDH-Experiment Strahlströme von
mehr als 3 nA bei einer Polarisation von max. 70 % erreicht.
Um eine größere Verfügbarkeit und Betriebssicherheit bei
Experimenten mit polarisierten Elektronen zu erreichen, wurde eine weitere
Quelle aufgebaut. Bei der Konstruktion dieser Quelle wurden neueste
Erkenntnisse berücksichtigt. Die mit einer Energie von 50 keV erzeugten
polarisierten Elektronen werden in den Linac 2 eingeschossen. Durch die neue
Strahlführung vom Linac 2 zum Synchrotron erreicht man eine stark
verbesserte Transfereffizienz. Die Quelle und der Linac wurden Anfang 2000
in Betrieb
genommen Mit dieser Quelle wurden am GDH-Experiment Strahlströme von
mehr als 3 nA bei einer Polarisation von max. 70 % erreicht.